|
|
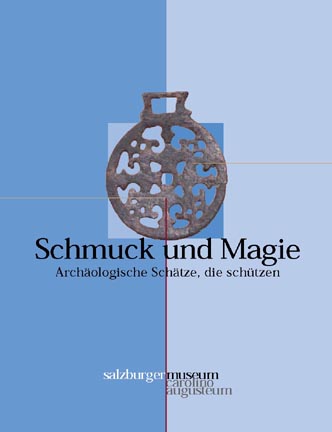 |
| Zur
Ausstellung erscheint zum Preis
von € 4,50 ein 48seitiger Katalog mit zahlreichen Farbabbildungen
|
| |
Die Sonderausstellung "Schmuck und Magie -
Archäologische Schätze, die schützen" präsentiert 74 ausgewählte
Schmuckobjekte, die mit wenigen Ausnahmen bei Ausgrabungen des
Salzburger Museums und der Landesarchäologie in Stadt und Land
Salzburg aufgedeckt wurden.
In einem weiten Bogen, der in der
Jungsteinzeit einsetzt und bis in die Neuzeit reicht, wird eine Art
Geschichte des Schmucks vor Augen geführt und ein Einblick in die
Vielfalt seiner Inhalte und Formen gegeben. Die Ausstellung bietet
aber auch Auskunft darüber, dass Schmuck nicht immer nur als reiner
Gebrauchs- und Ziergegenstand angesehen wurde, sondern auch
übergeordnete Funktionen erfüllte.
Schmuck galt schon von den ersten Anfängen
an als ein Signum von Stand, Würde und Reichtum, er unterstrich den
persönlichen Anspruch wie die soziale und gesellschaftliche Stellung
des Trägers. In vielen Fällen kam ihm jedoch auch eine zusätzliche
Wertigkeit zu, so dass er zum Sitz einer übernatürlichen Kraft und
zu einem magischen Mittel mit schutz- und heilbringender Wirkung
aufsteigen konnte. Schmuck war somit auch häufig der Ausdruck einer
Glaubensvorstellung, die in der Natur, in jeder Materie, in jedem
Zeichen und Körper eine Gruppe von geheimnisvollen Kräften angezeigt
sah. Er bildete daher auch das Element eines Denk- und
Handlungssystems, das sich mit diesen sonst nicht erklärbaren und
meist als überlegen und göttlich eingestuften Erscheinungen
auseinandergesetzt hat. Der magisch-religiöse Aspekt wird zwar nicht
immer sofort deutlich, doch ergibt sich die ambivalente Bedeutung
des Schmucks aus jeweils gut entschlüsselbaren Faktoren. Zum einem
zeigt sich der Symbolgehalt im Kriterium der äußeren Beschaffenheit
oder im Stoffwert des Materials selbst, die magische Komponente kann
sich zum anderen in einer ganz sinnfälligen Farb- und auffälligen
Formgebung äußern.
Die Doppelwertigkeit des Schmucks
erschließt sich gegebenenfalls auch bloß aus einem archäologischen
Kontext, wobei dem Fundort gleichwie der Fundsituation und den
Mitfunden eine erhebliche Rolle zukommt. Das Spektrum der Formen ist
mehr als beachtlich, bunt und vielgestaltig, die ausgestellten
Objekte umfassen alle nur denkbaren Formen. Neben schlichten
Bildungen finden wir völlig eigenwillige und faszinierende Formen
oder überaus reich verzierte und vom Motiv her interessante Gepräge.
Aus der Gattung des Ansteckschmucks gibt es Nadeln und Fibeln, aus dem Bereich des Halsschmucks Perlenketten und auch einzelne Anhänger und Glieder. Ferner liegen Ringe und Reife vor, die zum Bein- oder Arm- und Handschmuck gehören. Einzelne Beispiele wie Ohrgehänge, Medaillons und Gürtelbehänge gehören aber auch noch weiteren Gattungen an, die jüngsten Exemplare der Anhänger ordnen wir freilich schon dem Kreis der christlichen und noch heute üblichen Devotionalien zu.
An verwendeten Materialien begegnen ebenso die verschiedensten Stoffe, verarbeitet sehen wir Stein, Edelsteine und Edelmetall, wie Gold, Silber und Bronze, des weiteren Bernstein und Bein. Zudem erkennen wir Objekte aus Glas und Kieselkeramik sowie die vielfach gewählte und beliebte Kombination von mehreren Stoffen. Die Exponate sind durch die Grabungsbefunde meist sicher datiert und informieren somit auch jeweils über das für einen jeden historischen Zeitraum gültige Formrepertoire.
Zur Ausstellung erscheint ein Begleitheft, das sowohl eine generelle Einführung zum Thema enthält als auch einen vollständigen Katalog der Objekte, die von den Mitarbeitern der Archäologischen Abteilung Eva Maria Feldinger, Raimund Kastler, Wilfried Kovacsovics, Fritz Moosleitner sowie Antonio Tadic zusammengestellt wurden.
Dr. Wilfried
Kovacsovics
|
Bronzene Zierscheibe/Anhänger in
Durchbruchsarbeit. Römisch, 2./3. Jh. Fundort: Stadt Salzburg,
Kapitelhaus
1988. Dm 4,6 cm.

Ausstattung eines Kindergrabes mit
zwei Armspangen aus Bronze, einem herzförmigen Anhänger aus
Bronze
und einem gelochten Fischwirbel.
Späte Bronzezeit,
13. Jh. v. Chr.
Fundort: Klessheimer Allee
1993

Dreireihige Halskette mit 42
verschiedenfarbigen Glas- und 28 unregelmäßig geschnittenen
Bernsteinperlen. Frühmittelalterlich,
6./7. Jh. Fundort: Grödig
1986

Teile
einer Halskette mit zwei Anhängern und drei Kulgelperlen aus Gold. Frühmittelalterlich,
2. H. 7. Jh.
Fundort: Untereching, Gemeinde
St. Georgen
bei Salzburg, 1894

Benediktusmedaille aus Messing.
Neuzeitlich, 2. H. 17. Jh. FO: Stadt Salzburg, Goldgasse 16, 1992
|