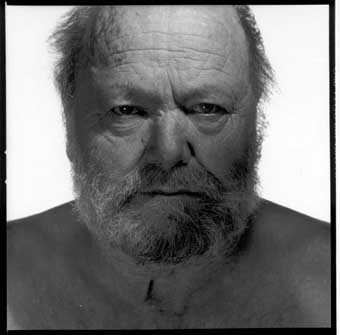 |
| Prof.
Josef Zenzmaier |
Josef Zenzmaier wurde 1933 in Kuchl/Salzburg geboren, besucht später die Fachschule Für Holz- Stein- und Metallbearbeitung in Hallein und absolviert eine Steinmetzlehre. Gerade in der Zeit des Nationalsozialismus wendet sich Zenzmaier der christlichen Religion und der Kirche zu, deren religiöse Feste im Jahreskreis ihn prägen und deren Themen aus altem und Neuen Testament ihn zeitlebens begleiten.
1951, während des Besuchs der in diesem Jahr
gegründeten Sommerakademie für bildenden Kunst lernt er Oskar Kokoschka kennen,
dessen Weltbild starken Einfluss auf ihn ausübt. Später besucht er die Klasse
des italienischen Bildhauers Giacomo Manzù und wird in den späten 50er Jahren
sein Assistent an der Sommerakademie und Mitarbeiter in dessen Werkstatt und
Gießerei in Mailand. Manzù ist im künstlerisches Vorbild, technischer
Lehrmeister und Freund, der ihm mit der Technik des Wachsausschmelzverfahrens
vertraut macht.
| |
 |
Büste Clemens
Holzmeister, 1981
|
1951 entsteht Zenzmaiers erstes
Auftragswerk einer Madonna für ein Privathaus in Kuchl, einige Jahre
später schuf er in der Pfarrkirche in Golling eine Marmorkanzel mit
den Evangelistensymbolen. Neben den zahlreichen Portraits, den Tierfiguren und Frauendarstellungen
bleibt Zenzmaiers Schwerpunkt die religiöse Thematik, die Kirche wird zu einem der
wichtigsten Auftraggeber. Es entstehen zahlreiche Altaraufbauten und -ausstattungen, beispielsweise in Golling,
Salzburg-Lehen oder in Plainfeld, jedoch auch in anderen Orten der
Diözese wie in Going oder in Schwoich in Tirol. Dabei
fertigt er nicht nur skulpturale Werke, sondern auch Tabernakel, Taufbecken, Taufgeschirre bis hin
zu den Bronzetoren und Türgriffen dieser Sakralräume.
Als eines seiner Hauptwerke gilt die Figur des
Virgils, der die Eingangshalle des nach Plänen von Wilhelm Holzbauer errichteten
Bildungshauses St. Virgil in Salzburg-Aigen dominiert. Trotz der gigantischen
Dimensionen verliert der wie eine zarte Epidermis aufgebaute Körper, den
Zenzmaier von innen nach außen und vice versa bearbeitet und aufbricht, jegliche
Schwere, das Schreiten des Heiligen wird zu einem leichtfüßigen, fast
überirdischem Schweben. Die letzten Jahre begleitet und beschäftigt ihn - neben
verschiedenen öffentlichen und privaten Aufträgen - die Figur des Paracelsus,
den er für die Naturwissenschaftliche Fakultät in Salzburg Feisaal schafft; eine
Figur und ein Thema der bzw. dem sich Zenzmaier in langjähriger intensiver
Auseinandersetzung annähert: eine Form und eine Struktur, die er findet und
verwirft, ein Ausdruck von früherem Pathos, der sich inzwischen zu einer inneren
Spannung verändert hat, der Renaissancemensch Paracelsus, dessen neugieriger
Forscherdrang sich sowohl im Aufbrechen der Oberfläche, einem Aufbrechen
früherer Denkstrukturen, als auch im Schreiten, einem geistigen Vorwärtsschreiten
zeigt.
Mag. Peter Husty